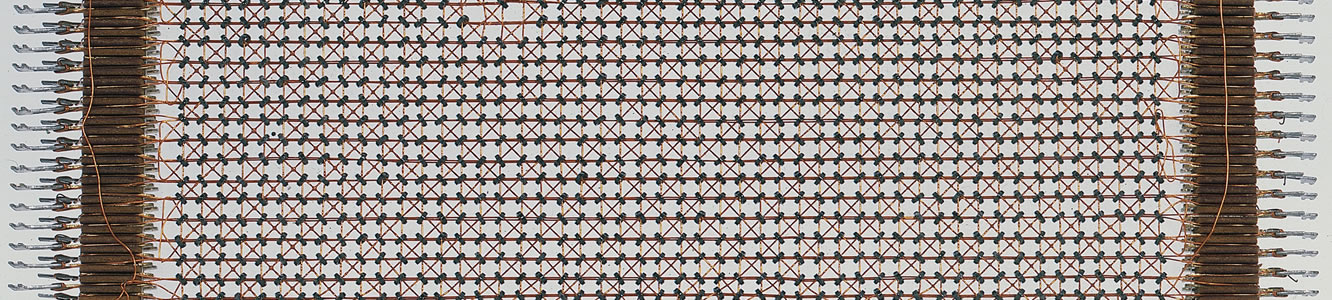Sag mir, wo die Manieren sind…
Geschrieben am 10.06.2016 von HNF
Als sich in 1990er-Jahren das Internet immer weiter ausbreitete, wurde noch über die korrekte „Netiquette“ gesprochen. Heute lesen wir Äußerungen im Netz, die oft gegen alle Regeln der Höflichkeit verstoßen. Wie kommt es, dass Menschen bei Kommentaren auf Internetseiten oder in sozialen Netzwerken ihre gute Kinderstube vergessen? Wir haben uns angeschaut, was Psychologen dazu herausfanden.
Vor über drei Jahrzehnten, im Oktober 1984, erschien ein längerer Artikel über sozialpsychologische Aspekte der Online-Kommunikation in der Fachzeitschrift American Psychologist. Die Autoren berichteten darin von Experimenten, bei denen jeweils drei Menschen in unterschiedlichen Umgebungen gemeinsam eine Aufgabe lösen mussten. Es ergab sich, dass von elektronisch vernetzten Teams mehr Flüche, Beleidigungen, Kraftausdrücke und aggressive Sprüche ausgingen als von den Gruppen, die zusammen im Zimmer saßen und sich mündlich austauschten.
Wie kommt’s? Ehe wir das klären, sei die Geschichte des Phänomens umrissen. Es entwickelte sich im frühen Internet und hieß damals Flaming. 1983 definierte es ein Hacker-Lexikon als „entnervende Dauer-Diskussionen über Belanglosigkeiten führen“. Die Debatten spielten sich in der Regel zwischen jungen Männern ab, die in universitären Rechenzentren saßen, und behandelte meistens technische Fragen. 1987 entstand die Flamer-Bibel. Sie zeigte, dass die Sitten rauer geworden waren. Die Bibel enthielt zwölf Gebote, das letzte lautete: „Im Zweifelsfall beleidigen.“
In den 1990er-Jahren machte das Netz durch die Erfindung des World Wide Web den großen Sprung nach vorn. Millionen von Menschen jeden Alters gingen online und erlebten die Vielfalt der Webseiten, die Debatten in Newsgroups und die Korrespondenz per E-Mail. Eine schöne neue Welt der globalen Kommunikation tat sich auf. Für den gehaltvollen Informationsaustausch gab es die Netiquette, den Knigge des Internets. Über die Mitwirkung in Mailinglisten hieß es dort unter anderem: „Nimm nicht an Diskussionen teil, um beleidigende Nachrichten zu posten.“
Der Traum eines geordneten Internets zerplatzte schnell. 2001 veröffentlichte der amerikanische Psychologe John Suler den Artikel The Online Disinhibition Effect – natürlich online. Auf Deutsch könnte man von Internet-Enthemmung sprechen. Suler unterschied einen positiven und einen negativen Typ. Die gutartige Enthemmung ist die Preisgabe von allerlei Wünschen und Wesenszügen, also der Online-Exhibitionismus. Die böse Form – Suler nannte sie „toxisch“ – ist das bereits erwähnte Flaming.
In seinem Artikel suchte Suler nach den Ursachen der Phänomene. Dazu listete er Merkmale auf, die Debatten am Computer beschreiben. Typisch sind demnach die Anonymität der User, ihre Unsichtbarkeit und die Pausen im Dialog. Charakteristisch sind auch das Imaginieren des Dialogpartners, das Loslösen der Debatte aus der Realität und die Gleichstellung der Debattenteilnehmer. Richtig erklären konnte John Suler die Online-Enthemmung nicht, er gab aber Anstöße für die Forschung.
Der Psychologe und Autor Daniel Goleman wies auf den präfrontalen Kortex hin, den Gehirnabschnitt hinter der Stirn, der das soziale Verhalten regelt. In einem Text über Cyber-disinhibition schrieb Goleman im Jahr 2006: „Damit dieser Regelungsmechanismus gut funktioniert, ist man auf das ständige Feedback des anderen angewiesen, und ein solches lässt das Internet nicht zu […] Wenn es jedoch kein Signal vom anderen zu überwachen gibt, stehen unsere Hemmschaltungen auf verlorenem Posten. Das genau führt zur Enthemmung, zu entfesselten Impulsen.“
Im Jahr 2011 erschien ein Aufsatz zweier Forscher der Universität Haifa zu unserem Thema. Noam Lapidot-Lefler und Azy Barak bildeten für ihre Studie 71 Paare von Versuchspersonen, die sich zuvor nicht kannten. Jedes Paar sollte online ein moralisches Dilemma auflösen, wobei auf den Monitoren unterschiedliche Bilder erschienen. Manche Teilnehmer sahen sich via Webcam ins Gesicht, andere erhielten vom Partner eine Seitenansicht, der Rest las nur die übersandten Botschaften.
Unterschiedlich wurde auch die Information über den jeweiligen Partner verteilt. Bei einem Teil der Paare erhielten die Teilnehmer Angaben zum Gegenüber, im anderen Teil erfuhr man nichts voneinander. Das Ergebnis der Studie war eindeutig. Am ruppigsten ging es dort zu, wo die Versuchspersonen anonym blieben und nur Texte austauschen konnten. Am besten benahmen sich die Paare, die nichts voneinander wussten, aber die ganze Zeit über Blickkontakt hielten.
Beim Online-Pöbeln bzw. bei seiner Vermeidung dürften also uralte menschliche Verhaltensweisen eine Rolle spielen. Die Erkenntnis bleibt aber unbefriedigend, denn sie geht auf einen Punkt nicht ein: die Leichtigkeit, mit der sich etwas im Netz posten lässt. Einen Leserbrief musste man sauber schreiben und zur Post bringen, und auch dann war noch längst nicht sicher, ob die Zeitung ihn abdruckt. Ein Internet-Kommentar ist schnell getippt, verschickt und kann, sofern kein Moderator aufpasst, sofort gelesen werden. Das fördert die Verbreitung von Stammtisch-Weisheiten und Schlimmerem.
An der Analyse von inhaltlichen Aspekten führt vermutlich kein Weg vorbei – wir erinnern auch an das Godwinsche Gesetz. Es gibt also noch einiges zu erforschen in der Psychologie der Websites, E-Mails, Weblogs und angeblich sozialen Netze. Mit der Trollkunde des Religionsexperten Michael Blume und der Masterarbeit von Christina Liebeck liegen auch Beiträge auf Deutsch vor. Die jüngste Publikation, das Buch Hass im Netz, stammt von der österreichischen Journalistin Ingrid Brodnig.