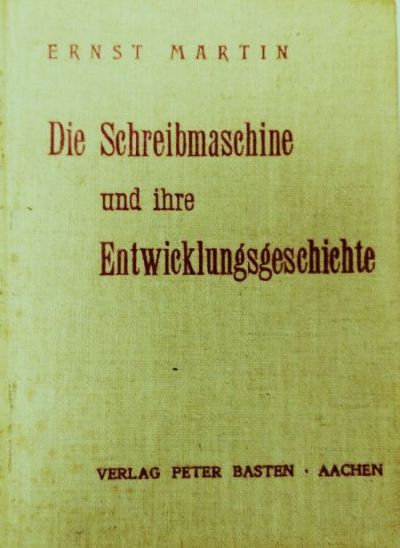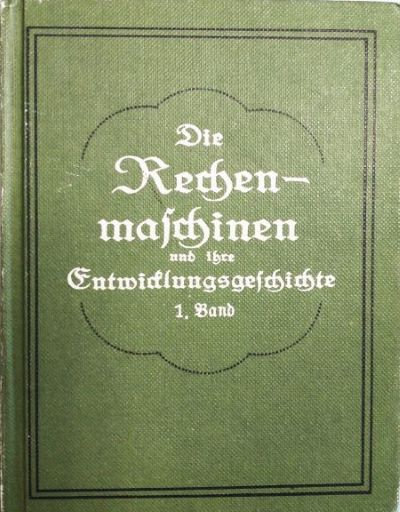In memoriam Ernst Martin (1885-1949)
Geschrieben am 25.04.2025 von HNF
Wer sich für historische Bürotechnik interessiert, kennt Ernst Martin. Vor hundert Jahren brachte er „Die Rechenmaschinen und ihre Entwicklungsgeschichte“ heraus; 1921 hatte er ein ähnliches Buch über Schreibmaschinen vorgelegt. Der 1885 geborene Autor benutzte ein Pseudonym; er hieß eigentlich Johannes Meyer. Von 1922 bis zu seinem Tod im Jahr 1949 lebte er im sagenumwobenen Pappenheim.
Neben dem Theologen Helmut Gollwitzer ist er der vermutlich bekannteste Pappenheimer; er wohnte jahrelang in dem sprichwörtlichen Ort in Mittelfranken und machte sich einen Namen in seinem Fachgebiet, der Geschichte der Bürotechnik. Ernst Martin kam aber nicht als Ernst Martin zur Welt, sondern als Johannes Meyer. Das geschah am 30. Juli 1885 im Dorf Frickenfelden, das heute zur Stadt Gunzenhausen gehört.
Meyers Vater hieß gleichfalls Johannes und war von Beruf Dorfschullehrer; mit der Zeit stellten sich sechs Brüder ein, eine Schwester starb jung. Der junge Johannes arbeitete als Büroangestellter in verschiedenen deutschen Städten sowie für die Schreibmaschinenfirma Underwood. Ab 1906 war Meyer als Fachjournalist für Bürotechnik in Paris, London und im schweizerischen St. Gallen tätig. Von 1916 bis 1918 diente er als Soldat für das Kaiserreich, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kehrte er in die Schweiz zurück.
Hier erschien 1921 unter dem Autorennamen Ernst Martin der erste Band des Buchs „Die Schreibmaschine und ihre Entwicklungsgeschichte“. 1922 zog Martin – wir möchten ab jetzt bei diesem Namen bleiben – nach Pappenheim; der Ort liegt dreißig Kilometer südöstlich von Gunzenhausen. 1923 brachte er den zweiten Band heraus; später wurden beide Teile mehrmals neu aufgelegt. Im April 1925 kam sein zweites Hauptwerk „Die Rechenmaschinen und ihre Entwicklungsgeschichte“; 1936 folgte davon eine erweiterte Version.
Ernst Martin starb am 31. Oktober 1949 in Pappenheim an einem Herzinfarkt. Auskünfte über sein Leben liefert die Broschüre Meyer/Martin – Das Werk eines guten Menschen, die der niederländische Büromaschinen-Historiker Jos Legrand 2009 zusammenstellte. Martins Schreibmaschinenbuch lässt sich in voller Länge und ohne Anmeldung im Internet Archive nachlesen. Vom Gegenstück über die Rechenmaschinen liegt online nur die englische Übersetzung aus dem Jahr 1992 vor. Sie beschränkt sich auf die Erstausgabe von 1925.
„Die Rechenmaschinen und ihre Entwicklungsgeschichte“ unterscheidet Rechenmaschinen im engeren Sinne für die Grundrechenarten und Addiermaschinen. In der Einführung legt das Buch fünf Gruppen fest, Rechenmaschinen mit Staffelwalzen und mit Sprossenrädern, schreibende Addiermaschinen mit Voll- und mit Zehnertastatur und Kleinaddiermaschinen. Danach folgt der Hauptteil, der chronologisch einzelne Fabrikate vorstellt. Er beginnt mit der Pascaline von 1642 – Ernst Martin wusste noch nichts von Wilhelm Schickard – und endet mit einer schwedischen Maschine namens Mercur.
Die erweiterte Ausgabe von 1936 enthält weitere Modelle, die alphabetisch aufgeführt werden, außerdem nahm Martin einige Buchungsmaschinen auf. Er plante eine Neufassung seines Werks, was sein plötzlicher Tod verhinderte. Das Rechnerlexikon bringt eine längere Korrekturliste; auffällig ist das Fehlen von Einfach-Addierern vom Typ Addiator. Vielleicht billigte Martin ihnen nicht den Status von echten Rechenmaschinen zu, denn sie enthalten außer den parallelen Zahnstangen keine beweglichen Teile.
In Ernst Martins Opus lassen sich noch immer Entdeckungen machen und Anregungen für Recherchen finden. So stießen wir auf den ziemlich vergessenen sächsischen Mathematiker Johann Michael Poetius (1680-1757), der 1728 in einem dicken Buch auch Konzepte für Rechenmaschinen vorstellte. Unbekannt war uns ebenso, dass die jüngere japanische Rechentechnik – nach dem Soroban mit seinen Kügelchen – im späten 19. Jahrhundert in Berlin begann. Zu dem betreffenden Erfinder Shohé Tanaka steht hier etwas mehr.
„Die Rechenmaschinen und ihre Entwicklungsgeschichte“ ist gemeinfrei, und es wäre eine gute Idee, einmal eine Online-Ausgabe der kompletten deutschen Version zu installieren. Auch Ernst Martins Wikipedia-Seite würde eine Auffrischung vertragen, zum Beispiel durch Hinzufügen von Portraitfotos – es gibt mindestens zwei. Unser Eingangsbild zeigt aber eine der Rechenmaschinen aus seinem Buch, das Modell E des Burkhardt-Arithmometers aus den 1920er-Jahren.